und andere Lehrer*
Wenn uns unsere Oma von ihren selbstgebackenen Plätzchen anbietet, nehmen wir uns eins und bedanken uns. Wir denken gar nicht dran, uns eine ganze Handvoll in den Mund zu stecken, uns noch beide Taschen voll zu machen, in die Speisekammer zu gehen und auch noch die Keksdose zu plündern.
Nun – es gibt viele Menschen, die das völlig normal finden. Zwar nicht bei der Oma, aber bei unserer Großen, der ganz Großen Mutter, der Erde. Und nicht nur die Keksdose.
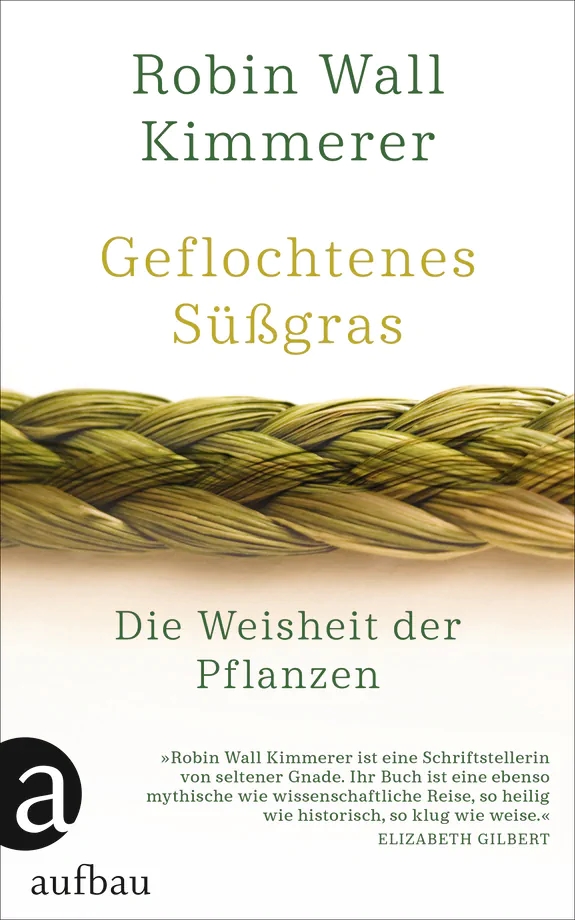
Das mit den selbstgebackenen Keksen von der Oma hab ich in dem Buch „Geflochtenes Süßgras“ von Robin Wall Kimmerer gefunden (2021, Aufbau Verlag).
Der Untertitel ist: „Die Weisheit der Pflanzen“.
Robin Wall Kimmerer ist Wissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Pflanzenökologie an der State University of New York.
Sie ist außerdem Mitglied der Citizen Potawatomi Nation in der Nähe der Großen Seen und verfügt über traditionelles indigenes Pflanzenwissen.
Kimmerer schreibt, wie sie sich voller Vorfreude aufs College für das Aufnahmegespräch vorbereitet und sich überlegt hat, wie sie einen guten ersten Eindruck machen kann – als Native besonders wichtig. Als sie gefragt wird, warum sie Botanik als Hauptfach gewählt habe, antwortet sie, stolz auf ihre tiefgründige und kenntnisreiche Antwort, dass sie sich für Botanik entschieden habe, weil sie lernen wolle, „warum Astern und Goldrute zusammen so schön aussahen.“ (Geflochtenes Süßgras, S. 53)

„Bestimmt lächelte ich in meinem roten Flanellhemd. Er dagegen lächelte nicht. Er legte den Stift nieder, als bräuchte man das, was ich gesagt hatte, gar nicht erst festzuhalten. „Miss Wall“, sagte er und fixierte mich mit einem gequälten Lächeln, „ich muss Ihnen sagen, das das keine Wissenschaft ist. Damit befassen sich Botaniker nun wirklich nicht. Doch er versprach, mich eines Besseren zu belehren. „Ich schreibe Sie in Allgemeine Botanik ein, dann können Sie lernen, worum es da geht.“ “ (ibid.)
Sie hat einen Fehler gemacht. „Unwissenschaftlich“, sie solle „an die Kunsthochschule gehen“ bekommt sie zu hören. Sie fängt an, an ihrem Wissen und ihrer Herkunft zu zweifeln. Ihrem Großvater wurden an seinem ersten Schultag die Haare abgeschnitten, alles, was er war und kannte, musste er aufgeben: seine Sprache, seine Kultur, seine Familie.
Dabei ist die Frage, warum Astern und Goldrute oft zusammen stehen und so prächtig aussehen, wirklich eine gute wissenschaftliche Frage: Violett und Gelb verstärken sich als Komplementärfarben gegenseitig – jede leuchtet mit der anderen zusammen kräftiger als allein – wir finden das schön, sie fallen auf, auch den Bienen.
Die Frage nach der Schönheit von Astern und Goldrute ist die Frage nach dem Zusammenspiel, dem Ursprung der Muster, die Frage nach Beziehungen und Verbindungen.

Wissenschaft trennt, analysiert, schaut die Dinge von außen an: „objektiv“. Kimmerer beherrscht die Sprache und das Denken der Wissenschaft. „Für ein Indianermädchen stellt sie sich bemerkenswert gut an,“ schreibt ein Berater in einem Empfehlungsschreiben.
Das indigene Pflanzenwissen weiß um Beziehungen, um die Verbindungen der Pflanzen untereinander, Mineralien, mit Landschaft, Klima, Tieren – und mit Menschen.
Kimmerer schätzt und benutzt beide Formen von Wissen und Erkenntnis. Sie zieht keine von beiden der Anderen vor – aber sie stellt die Vorherrschaft des wissenschaftlichen Denkens, das die Forschungs-“Gegenstände“ zu Objekten macht und vom Betrachter trennt, infrage. Und verbindet beide zu tieferem Wissen.
Die Kombination beider Weltsichten ergibt andere Fragen – und damit neue Antworten. Antworten, die uns Menschen das Überleben retten können.

Wie wäre das denn, wenn wir eine unbekannte Pflanze nicht fragen würden: „Was bist du? Was sind deine Bestandteile? Wozu nützt du?“ – sondern: „Wer bist du?“
Wie wäre das, wenn
- wir um Erlaubnis fragen würden, bevor wir etwas nehmen?
- wenn wir immer nur soviel nehmen, wie wir brauchen?
- und immer darauf achten, dass genug übrig bleibt?
- und wenn wir uns bedanken und immer etwas zurückgeben würden?
Wie wäre das, wenn wir uns der Erde, unserer Ur-Mutter, gegenüber genauso anständig benehmen würden wie bei der Oma?
Wir würden ganz anders ernten. Kimmer schreibt von der „ehrenhaften Ernte“. Wir würden unsere Gärten und Äcker, unsere Viehhaltung, die Jagd, Bergbau und Industrie völlig anders gestalten. Wir würden besser verstehen, wie alles zusammenwirkt. Wenn wir Menschen ein Teil der Natur sind und sie uns nicht als „Objekt“ gegenüberstellen, kann sie keine Ware sein. Ein anderes Wirtschaftssystem würde entstehen. Ein anderes Miteinander – auch zwischen uns Menschen.
Es wäre eine Revolution.
Eine Kultur der Dankbarkeit würde entstehen.
Wenn man sich vorstellt, vor jeder Sitzung des Bundestages würde gedankt: der Luft, die wir atmen, dem Wasser, das wir trinken, der Erde, die uns trägt und versorgt, den Tieren und Pflanzen, die uns helfen und uns ernähren.
Unvorstellbar?
Die Onondaga machen das. Am Anfang jeder Schulwoche und überhaupt jeder Versammlung wird gemeinsam gedankt. Alle indigenen Völker weltweit verbindet eine Kultur der Dankbarkeit.
Kimmerer schreibt: „Wenn man der Danksagung zuhört, fühlt man sich zwangsläufig reich. Und obwohl der Akt der Dankbarkeit vielleicht harmlos wirken mag, so ist es doch ein revolutionärer Gedanke. In einer Konsumgesellschaft ist Zufriedenheit ein radikaler Vorschlag. Wenn wir Überfluss erkennen statt Knappheit, untergräbt das eine Wirtschaft, die darauf beruht, dass stets neue Bedürfnisse geweckt werden. Dankbarkeit stiftet eine Ethik der Fülle, während die Wirtschaft Leere braucht.“ (ibid. S. 133)
Dieses Gefühl des Mangels, dass wir verlieren, wenn wir teilen, nicht richtig zu sein, nicht dazu zu gehören, haben uns die westlichen Religionen immer schon gegeben.


Wir haben einen männlichen allmächtigen Gott, der uns die Gesetze gibt und bedingungslosen Gehorsam verlangt. Der sagt, wir müssen im Schweiße unseres Angesichts arbeiten, uns die Erde untertan machen und unter Schmerzen Kinder gebären.
Bei den Indigenen Amerikas entsteht alles aus der Verbindung des Männlichen mit dem Weiblichen, aus einer Umarmung. Wir Menschen sind Mitschöpfer*. Die Pflanzen, schon so viel länger auf der Erde als wir, können uns lehren, wie man zusammenlebt und überlebt – ein Kompass, den wir selbst erkennen können, wenn wir hinhören, hinschauen, unsere Sinne und unseren Verstand gebrauchen. Verbindung aufnehmen. Jeder Mensch kann das, dafür brauchen wir weder Priester noch Wissenschaftler. Die Erde meint es gut mit uns und schenkt uns alles, was wir brauchen.
Und: für ein Geschenk hat man die Verantwortung.
Vor kurzem saß ich mit meiner kleinen Enkelin beim Käsestand, es waren noch ein paar Kunden vor uns dran. Da fragte sie mich: „Oma, wofür sind Menschen eigentlich da?“
Da antworte mal drauf!
Immer wieder hört man, am besten wäre es für die Natur, wenn wir Menschen von der Erde verschwinden würden. Am besten aussterben. Die Natur würde sich schnell erholen. Obwohl – wenn wir reich sind, könnten wir auch mit Elon Musk auf den Mars auswandern.
Ausgerechnet die, die am meisten zerstören, wollen sich davonmachen?! Erst alles kaputtmachen und sich dann verpissen – gehört sich das? Ist das anständig?

Was mir besonders gefallen hat an dem Buch „Geflochtenes Sußgras“, ist: Kimmerer sagt: wir Menschen gehören dazu. Es ist kein Zufall, dass es uns gibt. Wir haben eine Aufgabe auf der Erde.
Süßgras wird zum zeremoniellen Räuchern benutzt. Es werden auchKörbe daraus geflochten. Einmal baten die Korbflechterinnen die Botaniker*innen und Professorin Kimmerer, zu untersuchen, warum überall das Süßgras verschwunden war und ob das an ihren Erntemethoden läge. Die Frage wurde zum Dissertations-Forschungsprojekt einer von Kimmerers Student*innen.
Die Studentin legte mehrere Felder an: zwei, die nach den Regeln der ehrenhaften Ernte beerntet wurden und ein Kontrollfeld, wo gar nichts gemacht wurde.
Zwei Jahre lang protokollierte die Studentin das Wachstum der Gräser. Das Ergebnis: auf den Feldern, wo traditionell geerntet wurde, ging es dem Süßgras gut, es wuchs kräftig und gesund nach. Auf den nicht beernteten Kontrollfeldern ging das Gras stellenweise ein und war mit toten Halmen durchsetzt.
Mit ihren Messdaten und Tabellen bewies die Studentin, „dass Süßgras gedeiht, wenn es geerntet wird, und leidet, wenn es nicht geerntet wird. (…) Die Graswiesen sagen uns, dass für das Süßgras der Mensch zum System gehört, ja sogar ein notwendiger Teil davon ist.“ (ibid. S. 190)
Jedes Kapitel erzählt von einer persönlichen Begegnung Kimmerers mit einer Pflanze – und der Lehre, die ihr dabei geschenkt wird. Verflochten mit ihrem Leben, den Menschen in ihrem Leben, der Geschichte ihres Landes und ihres Volkes, dem indigenen Pflanzen-Wissen und ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
Kimmerer zeigt an vielen Beispielen, wie durch den Eingriff der Menschen Pflanzen gedeihen (Zucker-Ahorn, Schwarzesche, gezielter Einsatz von Feuer).
Es ist ein Geben und Nehmen.
Wir haben die Ver-Antwortung für das, was uns geschenkt wird. Wir müssen Antwort geben. Das ist unsere Aufgabe auf der Erde. Und der Sinn unserer Arbeit.
Was wir kaputt gemacht haben, müssen wir heilen. Die Moore vernässen sich nicht von selber wieder.
Zurück zur Frage meiner Enkelin. In Köln ist es üblich, dass die Menschen um einen herum mitdiskutieren, wenn ein interessantes Thema aufkommt. Alle zusammen haben wir beim Käsestand hin und her überlegt und uns schließlich darauf geeinigt, dass es doch ganz schön ist, dass es uns gibt.
Wenn man die Nachrichten hört, kann man manchmal verzweifeln. Ich frage mich schon mal, ob meine Urenkel*innen noch Möhren aus der Erde ziehen können. Im See schwimmen. Feldlerchen jubeln hören.
Oder ob sie Kriege erleben werden ums Wasser, um fruchtbares Land. Vor Krieg und Hunger fliehende Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Oder im Ahrtal, in Ozeanien und in Pakistan.
Die meisten Menschen wollen gar nicht unbedingt mit 200 über die Autobahn heizen, jeden Tag Schweinenacken essen und Öl, Kohle und Gas verbrennen.
Dass sich alles so langsam bewegt, kann einen verrückt machen.
Aber ich sehe auch, DASS sich etwas bewegt.
Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, die daran arbeiten und ihre ganze Kraft einsetzen, einen Unterschied zu machen und die Sache noch zu drehen.







Neulich las ich einen Bericht über die vier Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz wochenlang im Regenwald überlebt haben. Einheimische haben sie gefunden. Ein General der Armee, der dabei war, spricht von den Gnomen, die nach den Erzählungen der Indigenen im Wald leben; er berichtet, dass auch er den jungfräulichen Wald um Einlass gebeten hat und eine Schildkröte eine bedeutende Rolle gespielt habe bei der Rettung.
Ich spreche jetzt manchmal mit meinen Pflanzen im Garten.
Und was soll ich sagen: Sie antworten!
„Geflochtenes Süßgras“ ist in wunderbares Buch, das schönste Buch, das ich seit langem gelesen habe.

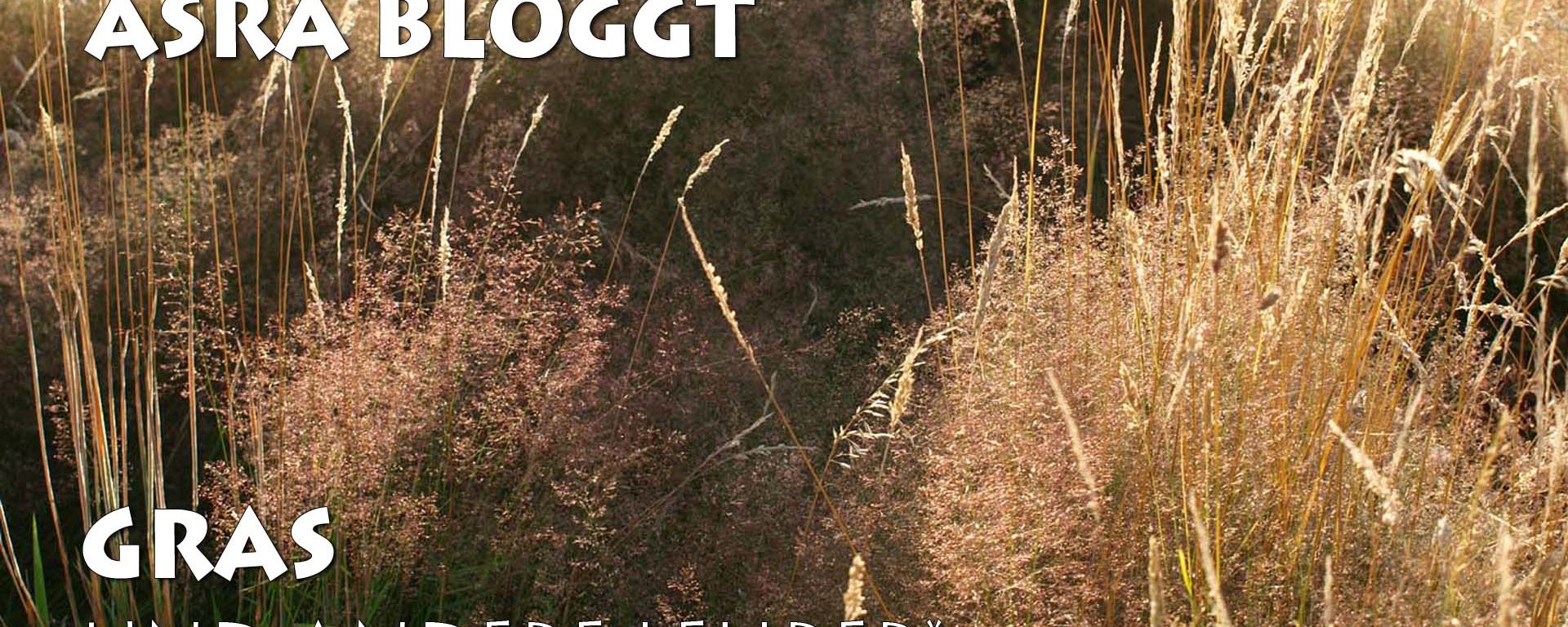
Ein Gedanke zu “GRAS”